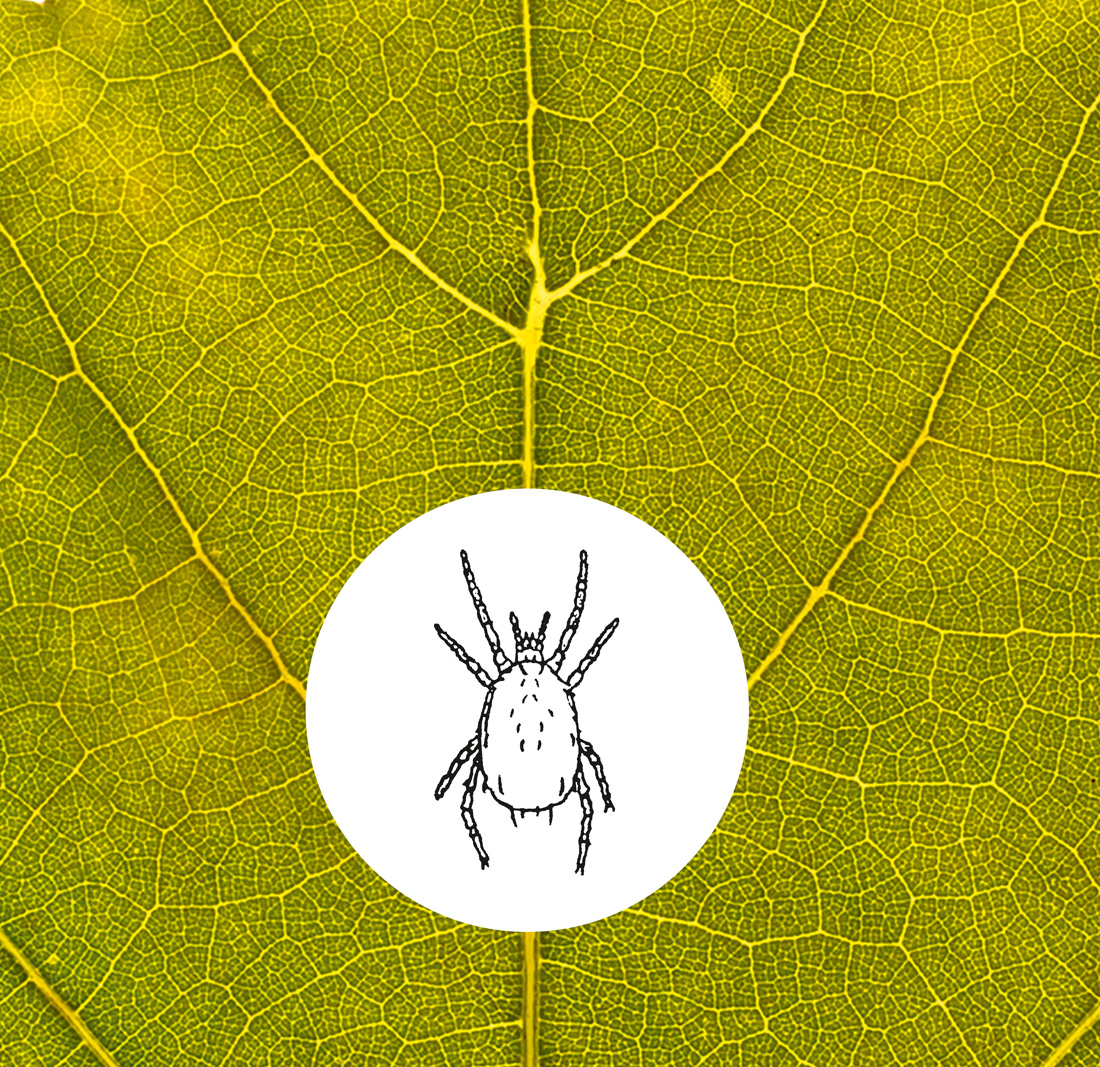Gras zwischen Rebstöcken
Grundlage für ein stabiles Ökosystem im Weinberg ist eine vielseitige Lebensgemeinschaft aus Rebstöcken, anderen Pflanzen, Tieren und dem Boden. Eine Begrünung zwischen den Rebzeilen fördert das Gleichgewicht der natürlichen Lebensformen und schützt gleichzeitig den Boden gegen Auswaschung. Die Dauerbegrünung für mehrere Jahre wird mit Klee, Gras und Wildkräutern (Löwenzahn, Vogelmiere) erreicht, eine Teilzeitbegrünung vom Herbst bis Frühling wird mit Einsaaten von z. B. Roggen, Winterwicken oder Rapsarten vorgenommen.